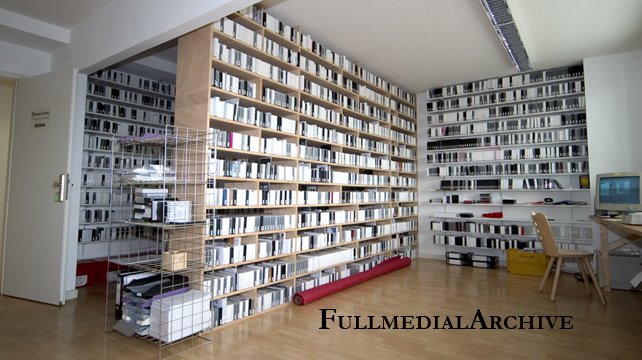Spiegel Online hat die "Nachricht" als erstes, die Süddeutsche zog heute in ihrer Online-Ausgabe nach. Und sogar die Bild-Zeitung platzierte das Thema heute ganz vorne. Die Geschichte: Tagesschau Chefredakteur Kai Gniffke und ARD-Hauptstadtstudio-Chef Ulrich Deppendorf kabbeln sich im Tagesschau-Blog. Der "Streit" dreht sich um das Eingeständnis von Gniffke, dass die Tagesschau in einer ihrer letzten Ausgaben ausschließlich Themen behandelt hätte, die nur dank der dem Sommerloch geschuldeten nachrichtenarmen Zeit einen Weg in die Sendung gefunden hätten. Originalzitat: "Alles reine Kann-man-machen-Nummern."
Offensichtlich leidet aber nicht nur die Tagesschau unter dem Sommerloch. Das es Redakteuren zweier großer deutscher Nachrichtenportale einfällt, ein solches Null-Thema auf ihre Seiten zu hieven, kann nur bedeuten: Es gab gerade nichts anderes. Der Nachrichtenwert einer Meinungsverschiedenheit zweier Medienmacher, die in der Bevölkerung ohnehin kaum jemand kennt, dürfte kaum messbar sein. Nichts gegen mediale Selbstkontrolle und selbstreflexive Berichterstattung. Aber wenn dabei Geschichten konstruiert werden, die keine sind, dann können wir darauf verzichten.
Posts mit dem Label Medien werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Medien werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Freitag, 24. Juli 2009
Donnerstag, 23. Juli 2009
Gebührenverschwendung? Gebührenverschwendung!
Das ZDF Heute-Journal hat ein neues Studio. Insider nennen es die "grüne Hölle", ob der ach so revolutionären "green screen"-Technologie. Natürlich hat das modernisierte Studio einige Millionen gekostet. Und das zu Recht, obwohl sich um die Kosten eine massive Debatte entzündet hat. Aber: Auch die öffentlich-rechtlichen Sender müssen mit der Zeit gehen, müssen investieren, um für die Zuschauer interessant zu bleiben. Der Vorwurf lautet: Gebührenverschwendung.

Ich würde unter Gebührenverschwendung aber weniger die Investitionen ins neue Studio verbuchen, sondern eher die Summen, welche die begleitende Werbekampagne gekostet haben dürfte. Nicht nur, dass auf allen relevanten News-Portalen massiv Bannerwerbung geschaltet wurde, auch im Print waren die Werber nicht untätig. Eine Banderole um die bundesweit erscheinende Tageszeitung Die Welt dürfte auch in Zeiten der Wirtschaftskrise nicht ganz billig sein. Und ein aufwändig gestaltetes Beilagenheft für den Spiegel dürfte sogar noch wesentlich gewesen sein.
Das Problem an diesen Werbemaßnahmen ist außerdem, dass sie fast ausschließlich in Medien für das "neue" Heute-Journal warben, aus deren Leserschaft sich auch das Stammpublikum der Sendung rekrutieren dürfte. Erschließung neuer, vielleicht auch jüngerer Zielgruppen: Fehlanzeige. Jene Fernsehzuschauer aber, die bislang das Heute-Journal gesehen haben, werden das auch weiterhin tun - und das neue Studio so oder so bemerken. Restaurants würden sich hüten, Stammgästen, die immer das gleiche Gericht bestellen, Werbung für eben dieses Gericht so massiv zu präsentieren.
Ganz davon abgesehen: Besagte Spiegel-Beilage reiht das neue Studio in eine Kette von Höhepunkten der Mediengeschichte - wie den Buchdruck oder den Telegrafen - ein. Böswillig könnte man dazu sagen: Gebührenverschwendung trifft Größenwahn.
Montag, 8. Juni 2009
Wohltuender Realismus - endlich!
Wollte man zählen, wie oft die klassischen Printmedien in den letzten Wochen und Monaten in den Tod geredet und geschrieben wurden - man müsste sich zusätzliche Finger, Hände und Arme anoperieren lassen. Die Vorsichtigen sind besorgt wegen der wachsenden Bedeutung des Internets und befürchten einen damit einhergehenden Qualitätsverlust des Journalismus. Als ob die Güte eines Textes und die Gründlichkeit einer Recherche tatsächlich vom publizierenden Medium abhingen. Die Apokalyptiker unter den Journalisten sehen ihre Gattung gar im Aussterben begriffen und würden das Rad der Zeit am liebsten zurück drehen.
Wie schön ist es da zu merken, dass es noch realistische Stimmen gibt. Diejenigen, die ganz einfach sehen, dass wir mitten in einem tiefgreifenden Medienwandel stecken, dessen Ende und Ergebnis wir noch nicht abschätzen können, der aber sicher nicht den Untergang des Qualitätsjournalismus bedeutet. Einer von diesen Köpfen ist offenbar Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung.

Programmatisch betitelt "Haltung bewahren!" begreift sein in der SZ Online-Ausgabe erschienener Text zum Thema den Medienwandel vor allem als Herausforderung an die Verleger und Journalisten:
"Selbst der Philosoph Jürgen Habermas und Dieter Grimm, der frühere, für die Pressefreiheit zuständige Bundesverfassungsrichter, haben für eine Staatsfinanzierung von Zeitungen geworben. Sie glaubten und glauben an die existentielle Not von Zeitungen - und ihre Antwort darauf ist eine fast verzweifelte demokratische Liebeserklärung. Doch die deutschen Zeitungen brauchen kein Staatsgeld. Sie brauchen Journalisten und Verleger die ihre Arbeit ordentlich machen. Sie brauchen Journalisten, die neugierig, unbequem, urteilskräftig, selbstkritisch und integer sind. Sie brauchen Verleger, die einen solchen Journalismus schätzen, die also von ihren Zeitungen mehr wollen als Geld, die stolz sind darauf, dass sie Verleger sind; und denen dieser Stolz mehr bedeutet als zwei Prozent mehr Gewinn. Und sie brauchen Leserinnen und Leser, denen die gute journalistische Arbeit etwas wert ist - womöglich viel mehr als die Abo-Kosten von heute, um so einbrechende Anzeigenerlöse auszugleichen."
Das Fazit: Anstatt sich davor zu fürchten, was die Zukunft wohl bringen mag, sollten Medienschaffende diese Zukunft aktiv mit gestalten. Nur selbstbewusste Journalisten sind in der Lage, Texte und Bilder zu schaffen, die Leserinnen und Leser interessieren und fesseln. Vor allem aber: Nur Journalisten, deren Budget es erlaubt, können diese Bilder und Texte aus Orten zusammen tragen, von denen es spannende, traurige, glückliche oder Wut auslösende Geschichten zu erzählen gibt. Anstatt sich vorrangig über Marktchancen und Medienkonkurrenz Gedanken zu machen, sollten Verleger also lieber in die Stärke ihrer Redaktionen investieren.
Wo diese Redaktionen ihre Inhalte dann veröffentlichen wird die Zeit zeigen. Und auch ein Geschäftsmodell wird die Zeit wohl bringen, denn wenn die Zeitung als Medium endgültig zu teuer geworden ist und vom Markt verschwindet, dann wird die Lesermasse zwangsläufig ins Netz wandern. Vor allem, wenn neue Technologien das Lesen von elektronischen Texten erleichtern. Denn nur ein Narr kann annehmen, dass das Surfen im Web in 5 oder 10 Jahren noch genau so aussieht wie heute. Wo aber die Lesermasse ist, da wollen auch die Anzeigenkunden sein. Und so werden die Werbeerlöse auch in elektronischen Medien wohl steigen. Es sei denn, der Journalismus hat sich bis dahin selbst beerdigt.
Freitag, 8. Mai 2009
Auflösungserscheinungen im Lokaljournalismus

Wer als freier Mitarbeiter für den Nordkurier arbeitet, dem blieb in den letzten Tagen nichts anderes übrig, als ein Papier mit dem Titel "Rahmenvereinbarung über die Freie Mitarbeit" zu unterschreiben. Darin wird ein völlig neues Arbeitsprinzip für die freiberuflichen Autoren festgeschrieben: Die Redaktion des Nordkurier nimmt ab sofort keine angebotenen Artikel und Fotos mehr an, sondern schreibt auf einer Internetplattform aus, welche Termine etwa zu besetzen und welche Themen zu bearbeiten sind. Die Freien können sich dann um diese ausgeschriebenen Jobs bewerben. Und zwar mit Angabe ihrer Honorarvorstellung. Ein Schelm wer denkt, dass hier Kalkül dahinter steckt. Denn das es hier zu einem ruinösen Preiskampf kommen wird, ist mehr als wahrscheinlich.
Schlimmer als diese bizarre Prozedere, das nicht nur Ausdruck einer Geringschätzung des Berufsbildes des freien Lokaljournalisten ist, sondern vor allem auch jegliche Eigeninitiative der Freiberufler überflüssig macht, sind jedoch die Aussagen des Geschäftsführers des Kurierverlages, Lutz Schumacher, dokumentiert in der SZ vom 8. Mai 2009. Im Verbreitungsgebiet des Nordkuriers gebe es kaum professionelle Freie, die von ihrer Arbeit leben müssten. Für den Verlag arbeiteten in erster Linie Schüler, pensionierte Lehrer und Hausfrauen. "Mit denen kann man es ja machen", drängt sich als gedankliche Fortsetzung auf.
Die zentrale Frage, die sich stellt lautet: Wie will der unter chronischem Auflagenschwund leidende Nordkurier auf Dauer seine Stellung als regionale Qualitätszeitung halten, wenn der Verlag zum einen keine ausgebildeten Redakteure und Autoren beschäftigt, die handwerklich gut geschriebene Geschichten ins Blatt heben? Und wenn er gleichzeitig seine freien Laien mit offenkundiger Geringschätzung behandelt. Offenbar kommt es der Verlagsleitung nicht mehr auf die Qualität der Zeitungsinhalte an. Vielmehr erwecken Schumachers Aussagen den Eindruck, dass es dem Leser seiner Meinung nach sowieso nicht auffällt, wie gut die Texte geschrieben sind. Folgt man dieser Logik, braucht eine Lokalzeitung tatsächlich keine professionellen Journalisten mehr.
Fazit: Die aktuell schwierige Situation der Tageszeitungen führt bei manchen Verlagsmanagern offenbar dazu, dass sie den Glauben ans eigene Produkt verlieren. Was sich hinter den Argumenten von Lutz Schumacher verbirgt, ist nichts anderes, als ein verlegerischer Offenbarungseid. Auf den durch das Internet ausgeübten Druck weiß man sich nur noch zu helfen, indem man die Qualität opfert und auf kostengünstige Inhalte setzt. Das sich die Zeitung dadurch selbst abschafft, fällt da kaum auf. Wenn es etwas gibt, mit dem die Tageszeitung ihre Relevanz unterstreichen und ihre Leser von der Kompetenz der Redaktion überzeugen kann, dann ist es inhaltliche Qualität. Dafür braucht die Redaktion aber professionelle Autoren. Das gilt für bundesweit erscheinende Qualitätszeitungen wie die Süddeutsche und die FAZ, aber auch für regionale und lokale Blätter wie den Nordkurier. Zeitungen, die wie letzterer verfahren, beschleunigen den Sturz in die Bedeutungslosigkeit. Man kann nur hoffen, dass die Verlagsbranche ihr Selbstbewusstsein nicht völlig verliert, sondern dass sich hier noch Visionäre finden, die erkennen, dass Investitionen in Qualität der einzig Erfolg versprechende Weg sind.
Montag, 20. April 2009
Hilflose Medienanalyse

Eigentlich sollte er wissen wovon er spricht, denn immerhin ist Paul E. Steiger ehemaliger Chefredakteur des Wall Street Journal und heute Leiter des unabhängigen Redaktionsbüros ProPublica mit Sitz in Manhattan, das sich der investigativen Recherche verschrieben hat. In Wozu noch Zeitungen?, dem lesenswerten Interviewband der deutschen Journalisten und Medienwissenschaftler Stephan Weichert, Leif Kramp und Hans-Jürgen Jakobs, formuliert Steiger jedoch eine seltsam hilflos wirkende Daseinsberechtigung der guten alten Zeitung angesichts des medialen Funktionensynkretismus des Internets.
Print biete den Vorteil, dass es "einen Anfang, eine Mitte und ein Ende gibt". Außerdem könne man Zeitungen überall mit hinnehmen, es handele sich um abgeschlossene Gebrauchsanleitungen, die über alles Wichtige informierten. Im Internet dagegen finde sich immer noch ein weiterer Link, den man anklicken könne. Steiger vergleicht hier Äpfel mit Birnen: Eine Zeitung ist nicht mit dem Internet zu vergleichen, höchstens mit dem Online-Auftritt eines Mediums oder einer Online-Zeitung. Auch hier finden sich Anfang, Mitte und Ende. Wenn ich Links finde, die ich anklicken kann, ist das in etwa dasselbe, als wenn ich mir in einem weiteren Print-Magazin zusätzliche Informationen besorge, die ich in der Zeitung nicht finden konnte. Finde ich im Netz bei einer Recherche kein Ende, ist nicht das Internet Schuld, sondern mangelnde Medienkompetenz und Selbstkontrolle.
Mittlerweile sind Internet-User auch lokal nicht mehr gebunden, das dürfte selbst der 1942 geborene Steiger mitbekommen haben. Spätestens seit Blackberry und iPhone, können Nachrichten und Informationen überall abgerufen werden. In Zukunft wird das dank neuer User-Endgeräte sogar noch einfacher sein. Widersprüchlich wird Steiger schließlich, wenn er der gedruckten Zeitung bescheinigt, sie mache auf Dinge aufmerksam, von denen man gar nicht wusste, dass sie einen interessieren. Aber ist das nicht gerade die Funktion von Links? Und gibt es diese Art von Verweisen nicht vor allem im Internet? Was Steiger also schon für Printmedien diagnostiziert, gilt vor allem für elektronische, denen es wesentlich leichter fällt, auf externe Inhalte zu verweisen, die man vorher nicht kannte und von denen man nicht dachte, dass sie thematischen Reiz besitzen.
Fazit: Nicht nur Star-Journalisten wie Paul Steiger fällt es schwer, den Wert gedruckter Zeitungen zu beschreiben. Das einfache Vermitteln von Nachrichten ist es jedenfalls nicht, das kann das Internet dank seiner multimedialen Eigenschaften wesentlich besser. Weder in Punkto Bild, Film, Grafik noch in Punkto Textlänge gibt es hier Beschränkungen. Vielleicht sind es gerade die sinnlichen Elemente der Zeitungslektüre, die der Zeitung das Überleben in der Zukunft ermöglichen. Das Rascheln des Papiers, der Geruch, das Lebensgefühl, mit der Süddeutschen im Café zu sitzen. Das wird die Auflagenzahlen zwar nicht stabil halten, das völlige Verschwinden jedoch verhindern. Aufgabe der Journalisten und vor allem der Verleger wird es sein, neue Erlösmodelle zu finden. Denn wir befinden uns mitten in einem technologieinduzierten Medienwandel - und solche haben sich noch nie aufhalten lassen.
Abonnieren
Posts (Atom)